Autor/ Autorin
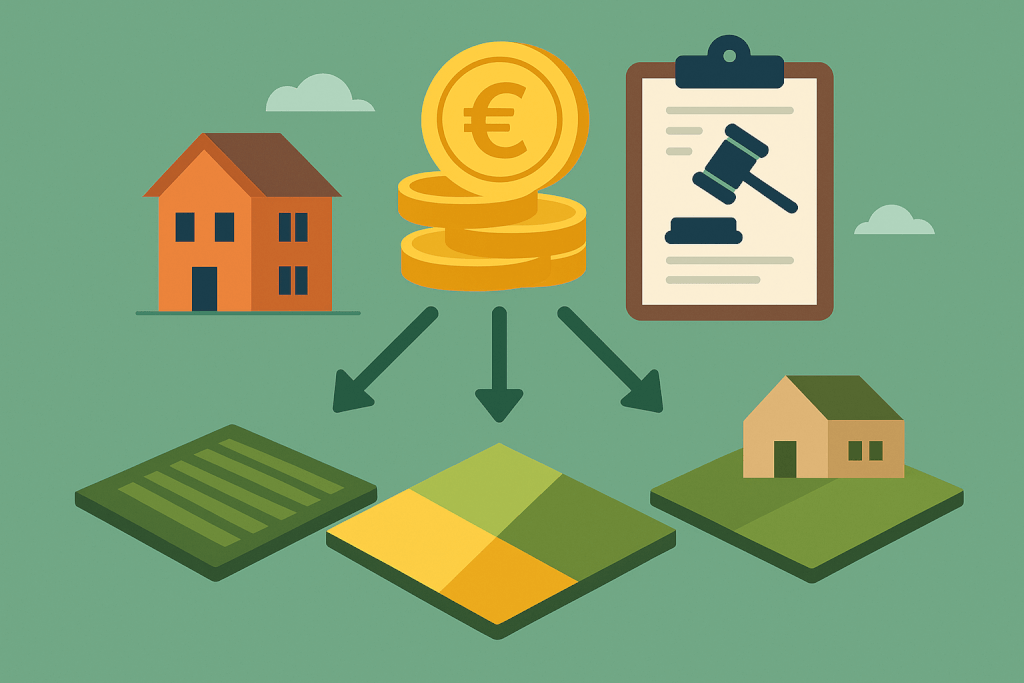
Diese Frage stellen sich derzeit viele unserer Kunden. Leider lässt sich diese Frage nicht so einfach beantworten, gibt es doch viele Punkte, die hier berücksichtigt werden müssen.
In folgendem Blogbeitrag versuchen wir, etwas Licht ins Dunkel zu bringen und verschiedene Umlagemodelle mit ihren Vor- und Nachteilen zu beleuchten.
Mit der Grundsteuerreform praktizieren die Finanzämter in den neuen Bundesländern erstmals das Vorgehen, sämtliche land- und forstwirtschaftlichen Flächen eines Eigentümers zu einem einzigen Grundsteuerobjekt zusammenzufassen. Zugleich wurde die Veranlagung von den Pächtern auf die Eigentümer umgestellt. Für Eigentümer, die ihre Flächen nicht selbst bewirtschaften, entsteht dadurch die Herausforderung, den Gesamtbetrag der einzelnen Grundsteuerobjekte gerecht und mit vertretbarem Aufwand auf zahlreiche Pächter zu verteilen.
Ganz besonders betroffen sind hierbei die grundsteuererhebenden Gemeinden selbst. Durch die Annahme und Behandlung der Gemeinden als Betriebe für Land- und Forstwirtschaft und der damit einhergehenden Zusammenfassung aller land- und forstwirtschaftlichen Flächen zu einem einzigen Grundsteuerobjekt - mit einem Umfang von oft mehreren Hundert Flurstücken - fehlt die Grundlage für die genaue Verteilung auf die Nutzer und Pächter dieser Flächen. Die seitens der Finanzämter erteilten Grundsteuerwert- und Grundsteuermessbescheide lassen keine Rückschlüsse auf die Grundsteueranteile der einzelnen Flurstücke zu.
Nach der Auffassung der ARCHIKART Software AG erfüllen diese Grundsteuerobjekte nicht die Kriterien einer wirtschaftlichen Einheit nach dem §2 Bewertungsgesetz (BewG), weil die zusätzlichen Kriterien neben dem Kriterium „derselbe Eigentümer“ schlichtweg nicht beachtet wurden.
Eine pachtvertragsgenaue Ermittlung der Grundsteueranteile nach den Bewertungskriterien der Reform ist daher nicht möglich: Der damit verbundene Verwaltungsaufwand wäre unverhältnismäßig hoch und würde die Umlage unwirtschaftlich machen. Daher sind vereinfachte Umlagemodelle erforderlich, die zugleich vertraglich abgesichert werden müssen.
Da es hierzu keine gesetzlichen Regelungen gibt, kommt der Vertragsfreiheit eine besondere Bedeutung zu. Ziel ist es, für alle Vertragspartner eine faire und handhabbare Lösung zu finden.
Im Folgenden stellen wir verschiedene Umlagemodelle vor und bewerten deren Vor- und Nachteile.
Prinzip: Die Grundsteuer wird in einem pauschalen Pachtzins oder einem separaten flächenbezogenen Beitrag für Grundsteuer / Grundbesitzabgaben abgegolten.
Vorteile:
Nachteile:
Prinzip: Verteilung des Gesamtgrundsteuerbetrages, anteilig nach den Flächenverhältnissen der Vertragsflächen zur Gesamtfläche des Grundsteuerobjektes.
Vorteile:
Nachteile:
Prinzip: Umlage des Gesamtgrundsteuerbetrages differenziert nach Art der Nutzung und gepachteten Flächenanteil (z. B. Acker, Grünland, Wald, Sonderkulturen).
Vorteile:
Nachteile:
Eine exakte Berechnung und Ermittlung der Grundsteueranteile je Vertrag-/Vertragsfläche auf Basis der gesetzlichen Bewertungs- und Berechnungsmethoden der Finanzämter ist aus fachlichen und wirtschaftlichen Gründen nicht umsetzbar.
Von der pauschalen Umlage nach anteiliger Fläche (Modell B) ist abzuraten, da sie bei nicht homogenen Grundsteuerobjekten (verschiedenen Nutzungsarten) zu Ungerechtigkeiten und zu Einnahmeverlusten für die Eigentümer führt.
Bevorzugt werden sollten daher die Modelle A und C
Weil eine exakte Berechnung der Grundsteuerbeträge für die einzelnen Vertragsflächen nach den komplexen steuerlichen Bewertungskriterien nicht praktikabel und leistbar ist, muss auf entsprechenden Umlagemodelle, basierend auf den Daten der Grundsteuerwertbescheide, zurückgegriffen werden.
Eine pragmatische und einfache Lösung biete die pauschale Umlage der Grundsteuer nach Model A (Bruttopacht / Flächenpauschale). Der Grundsteuerumlagesatz kann für die Zukunft mit Puffer kalkuliert und andere Grundbesitzabgaben direkt mit einkalkuliert werden. Die mögliche zyklische Anpassung des Umlagesatzes sollte bei diesem Modell vorgesehen und vertraglich vereinbart werden.
Das Modell B zur pauschalen flächenanteiligen Berechnung ist nur für Grundsteuerobjekte mit einer einzigen Nutzungsart geeignet.
Am gerechtesten ist unserer Meinung nach die Umlage der Grundsteuer unter Berücksichtigung der Nutzungsarten (Model C).
Um unsere Anwender bei dieser Thematik zu unterstützen, haben wir uns entschieden, das nutzungsartenbezogene Umlagemodell (Modell C) in ARCHIKART umzusetzen. Mit der Lizenzerweiterung „Umlage Grundbesitzabgaben“ wird ARCHIKART das Modell ab der Version 4.80 (verfügbar voraussichtlich ab Ende 2025) unterstützen.
In einem unserer nächsten Blogbeiträge erfahren Sie mehr zur konkreten Umsetzung in ARCHIKART.
Bei der Umlage der Grundsteuer gibt es aufgrund der Vertragsfreiheit kein allgemeingültiges „Richtig“ oder „Falsch“. Wichtig ist, dass die gewählte Lösung transparent und vertraglich eindeutig und mit Rückwirkung ab 2025 geregelt wird.
Angesichts der hohen Nachfrage nach landwirtschaftlichen Pachtflächen gehen wir davon aus, dass viele Vertragspartner bereit sind, entsprechende Anpassungen bei der Grundsteuerumlage mitzutragen.
Autor/ Autorin
Was denkst du?